Rezension: Bschor – Antidepressiva
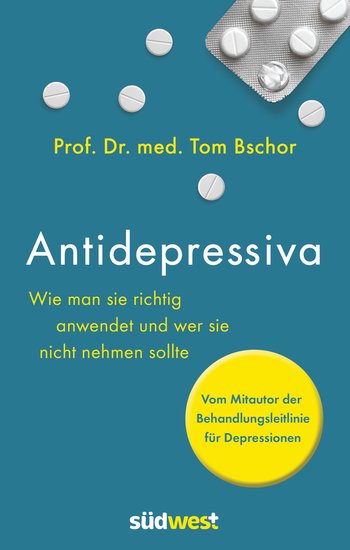
Zu den interessantesten Büchern über Antidepressiva des vergangenen Jahres zählt Tom Bschors Antidepressiva – Wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte.
Bereits im Untertitel findet sich ein Tabubruch, denn kein anderer deutscher Psychiatrieprofessor würde schreiben: Es gibt Menschen, die sollten lieber keine Antidepressiva einnehmen. Viel verbreiteter ist die Empfehlung: Nehmen Sie Antidepressiva: Gegen Depressionen, gegen Überlastung, gegen Zwänge, gegen Phobien, gegen Sorgen, gegen Wechseljahre Beschwerden, gegen chronische Schmerzen, gegen Fibromyalgie, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Suchterscheinungen, gegen Trauer oder Lebenskrisen. – Tatsächlich werden aktuell 1,5 Milliarden Tabletten Antidepressiva pro Jahr in Deutschland verschrieben. Damit können 5 Prozent der Bevölkerung versorgt werden.
Bschor erklärt: „Eigentlich ist es naheliegend und unmittelbar einleuchtend, dass ein Medikament, das nicht hilft, nicht einfach weiter eingenommen wird. Dennoch zeigt die tägliche Erfahrung, dass vielen Patienten Antidepressiva trotz Unwirksamkeit über Monate oder sogar Jahre weiter verordnet wird. Verlangen Sie von Ihrem Arzt in diesem Fall, dass er mit Ihnen die Behandlungsstrategie ändert.“(S.188f)
Er ergänzt: „Erstaunlicherweise wird in der Behandlungsrealität die Entscheidung zum Absetzen (zu) selten getroffen und zu oft bedeutet „einmal Antidepressivum – immer Antidepressivum“. (S. 189).
Er entlarvt die Betriebsblindheit von Kollegen, die vergessen haben, dass Depressionen in den allermeisten Fällen von alleine aufhören: „Es ist bekannt, dass die Wirkung von Antidepressiva mit der Zeit kontinuierlich zunimmt. Es wäre aber sogar denkbar, dass die beobachtete Besserung lediglich dadurch bedingt ist, dass depressive Erkrankungen die Tendenz haben, auch irgendwann von alleine abzuklingen.“ (S.195) und „Die meisten Depressionen klingen auch ohne Behandlung irgendwann wieder ab, sie halten typischerweise aber für viele Wochen oder Monate an.“ (S. 31)
Zudem widerspricht er dem verbreiteten Glauben, es müsse nur das richtige Mittel gefunden werden, egal wie häufig man das Medikament wechselt.
„Dringend abgeraten werden muss aber von langen Aneinanderkettungen immer neuer Antidepressiva, wie sie im Behandlungsalltag immer noch beobachtet werden: An das dritte gescheiterte Antidepressivum reiht sich das vierte heran das fünfte, hieran das sechste … Widersprechen Sie einem solchen Vorgehen, wenn Ihr Arzt Ihnen dazu rät.“ (S. 197)
Sofern sich Arzt und Patient für eine medikamentöse antidepressive Therapie entscheiden, rät Bschor maximal einmal das Medikament zu wechseln und jedes Medikament nur vier bis sechs Wochen lang auszuprobieren. Wenn in dieser Zeit keine Verbesserung eintritt, sollte über die Strategie nachgedacht werden „ganz auf eine weitere medikamentöse Therapie zu verzichten“ (S. 201).
Ein ganzes Kapitel namens „Entzugssymptome“ widmet er der Absetzproblematik:
„Es ist mittlerweile unstrittig, dass bei bis zu einem Drittel aller Patienten Entzugssymptome auftreten, wenn sie nach längerer Dauer die Antidepressiva-Einnahme beenden. Meistens sind die Entzugssymptome von kurzer Dauer und harmlos, … . In einigen Fällen sind Entzugssymptome aber gravierend oder gefährlich“. (S. 114)
Insgesamt bescheinigt er Antidepressiva eine schwache Wirksamkeit: „Die von Cipriani und seinen Kollegen ermittelte Effektstärke für die 21 Antidepressiva zusammengenommen beträgt 0,3. Sie ist daher als klein zu bezeichnen. Der von den Wissenschaftlern festgestellte schwache Effekt deckt sich dabei mit der täglichen Erfahrung von Psychiaterinnen und Patientinnen … (S. 78)
Er erklärt, dass der Placeboeffekt den größten Anteil an der Wirkung der Antidepressiva hat: „Das Fazit daraus lautet, dass unstrittig ein sehr großer Anteil der positiven Wirkung eines Antidepressivums lediglich auf den Placeboeffekt zurückgeht.“ (S. 83)
Man fragt sich: Wirkt denn ein Antidepressivum überhaupt gegen die Ursache einer Depression?
An dieser Stelle muss Bschor passen. „Die Wissenschaft muss zugeben, dass sie bezüglich der Entstehung von Depressionen noch ziemlich im Dunkeln tappt,“ (S. 11) was natürlich an der hohen Komplexität des Gehirns liegt, „dessen Arbeitsweise bislang nur in Ansätzen verstanden ist.“ (S. 22) Labordiagnostik und naturwissenschaftliche Beweise sind damit überfordert. „Die Diagnose Depression kann hiermit aber nicht bewiesen werden, da bei einer Depression alle Labor- und Röntgenuntersuchungen ein unauffälliges Ergebnis liefern.“ (S. 27) „Woher kommt denn nun eine Depression? … Die einfache, aber enttäuschende Antwort lautet: Wir wissen es nicht genau.“ (S. 27).
„Auch die strikte naturwissenschaftliche Forschung hat keine klaren Erklärungen für Depressionen geliefert. Depressionen sind jedenfalls nicht die Ursache eines Serotoninmangels oder eines Mangels an anderen Nervenbotenstoffen, Vitaminen oder Hormonen.“ (S. 30). Später ist zu lesen:
„Ein Serotoninmangel konnte bei depressiven Menschen noch nie nachgewiesen werden – weder im Vergleich zu gesunden Menschen noch im Vergleich zu depressionsfreien Zeiten.“ (S. 90)
All diese Aussagen findet man auch in „Unglück auf Rezept“. Und das lässt ein zweischneidiges Gefühl entstehen, denn auf der einen Seite freut man sich, die Erkenntnisse nach mehreren Jahren auch an anderer Stelle zu lesen, aber gleichzeitig überrascht es, dass Bschor dies jetzt als eigene Geschichte verkauft.
Es finden sich viele weitere Übereinstimmungen, zum Beispiel wenn es um die biochemischen Mechanismen der Antidepressiva geht:
„Tatsächlich unterscheiden sich die verfügbaren Antidepressiva trotz ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Untergruppen auch nicht grundsätzlich in ihrem mutmaßlichen Wirkprinzip. Mutmaßlich deshalb, weil es inzwischen Zweifel daran gibt, ob der pharmakologische Effekt, der sich hinter den Namen der verschiedenen Untergruppen verbirgt tatsächlich für den Behandlungserfolg verantwortlich ist.“ (S. 37)
Bschor führt über die biochemische Wirkung an der Synapse aus:
„Lange wurde dies auch als der pharmakologische Weg, über den sie die Depression positiv beeinflussen, angesehen. Aufgrund verschiedener Widersprüche gibt es aber erhebliche Zweifel, ob dieser Effekt von Antidepressiva im synaptischen Spalt etwas mit ihrer antidepressiven Wirkung zu tun hat.“ (S. 41)
„Fazit: Zweifel an der Wirksamkeit von Antidepressiva
Unstrittig ist, dass der größte Anteil der Wirkung von Antidepressiva auf den Placeboeffekt zurückgeht, wobei betont werden muss, dass der Placeboeffekt ein Effekt ist, der die Heilung unterstützt. … . Selbst dieser geringe Anteil [die Wirksamkeit des Antidepressivums] ist möglicherweise überschätzt, da in den RCTs, … keine aktiven Placebos verwendet … [ausgewählte] Patienten untersucht wurden, … negative Studien unter den Teppich gekehrt wurden … Studien teilweise so konzipiert wurden“. (S. 89)
Nach all diesen Zitaten könnte der Leser denken, Bschor habe den Mythos der Antidepressiva entlarvt und empfiehlt daher keine Patienten mehr mit diesen Mitteln zu behandeln (so wie es Prof. Uwe Gonther tut). Oder die häufig beobachtete Absetzproblematik führt dazu, dass er sich nur für eine sehr viel seltenere Verschreibung ausspricht (so wie es Prof. Udo Voderholzer tut).
Doch es passiert etwas ganz anderes. Das Buch erhält einen Riss. Wir erleben eine Zweiteilung.
Auf der einen Seite lesen wir von dem WISSENSCHAFTLER Tom Bschor, der in seitenlangen Ausführungen erklärt, Antidepressiva, insbesondere SSRI-Antidepressiva, senken NICHT die Suizidrate (hier ist er am überzeugendsten), können ernsthafte Nebenwirkungen verursachen und schwierige Absetzproblematiken auslösen. Aber auf der anderen Seite lesen wir von dem ARZT Tom Bschor, der nicht sehr viel anders argumentiert, als der niedergelassene Praktiker von nebenan.
Tatsächlich empfiehlt Bschor Amitriptylin zur dauerhaften Schmerztherapie einzusetzen, Duloxetin zur Behandlung von diabetischer Polyneuropathie (obwohl es dafür keine guten Studien gibt und es sich nur um sehr wenige Patienten handelt) und mehrere andere Antidepressiva sollen gut als Einschlafhilfen dienen.
Er erklärt, dass man Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen und Schlafstörungen mit Antidepressiva behandeln kann und empfiehlt beim Eintritt einer Besserung die antidepressive Medikation sechs bis neun Monate weiter beizubehalten (Erhaltungsdosis) und verspricht:
„Je länger man das Antidepressivum über die Gesundung hinaus weiter einnimmt, desto länger hat man auch einen besseren Rückfallschutz.“ (S. 186)
Dabei soll sogar eine jahrelange Medikation sinnvoll sein:
„Betroffenen mit einem solchen hohen Rückfallrisiko kann man daher zu einer langfristigen Fortführung der Antidepressivamedikation zur Rückfallprophylaxe raten. Grundsätzlich ist auch eine Antidepressiva-Einnahme über viele Jahre verträglich und es gibt Patienten, die sogar über Jahrzehnte Antidepressiva verordnet bekommen.“ (S. 188)
Schwierige Phasen, die Patienten nach dem Weglassen einer jahrelangen Antidepressiva-Medikation durchleiden, erklärt er mit dem Rebound-Phänomen:
„Nach dem Absetzen der Medikamente kann es zur Rückkehr der ursprünglichen Erkrankung bei Antidepressiva also einer Depression, kommen, ferner zu Entzugssymptomen (auch Absetzsymptome genannt) oder zu einem Rebound – so wird die verstärkte oder beschleunigte Rückkehr der Depression genannt.“ (S.110)
Dazu führt er aus:
„Es handelt sich also nicht nur um die Rückkehr der Krankheit, nachdem ein wirksames Medikament weggefallen ist, sondern es handelt sich auch um die Erhöhung des Erkrankungsrisikos. (S. 117)
Eine alternative Erklärung wäre die Depressionsspirale: Nach langer Einnahme ist der Körper der Patienten von den Medikamenten abhängig geworden. Jeder Versuch die Medikamente zu entziehen führt zur Ausbildung schwerster Entzugssymptome. Diese Entzugssymptome werden stets als Wiederkehr der „Grunderkrankung“ gedeutet. Deshalb werden die Medikamente nach einer bestimmten Zeit (im Tal der Verzweiflung) stets wieder angesetzt. Die Entzugssymptome hören dadurch auf. Und es folgt der zynische Satz: „Sehen Sie, Sie brauchen die Medikamente noch immer.“
Etwas irritierend lesen sich zudem einige seiner Einschätzungen zur Entzugsproblematik. Beispielsweise schreibt er über Fluoxetin (Prozac):
„Fluoxetin schleicht sich sozusagen selber aus, auch ohne tägliche Reduktion der Dosis.“ (S. 114)
Beim Lesen dieser Zeile erhält man den Eindruck, Bschor hat bislang nur wenige Patienten im Entzug begleitet. Möglicherweise fehlen aus diesem Grund auch Tipps wie ein erfolgreiches Absetzen funktionieren kann.
Bemerkenswert ist zudem seine Einstellung zur Psychotherapie. Obwohl er schreibt, dass eine Psychotherapie besser geeignet ist, um Rückfälle innerhalb von zwei Jahren zu verhindern (S. 121), schreibt er an anderer Stelle:
„Leider ist auch eine psychotherapeutische Behandlung nicht ohne Probleme. Im Vergleich zu medikamentösen Therapien ist Psychotherapie sehr viel zeitaufwendiger. Nicht jeder Patient kann problemlos wöchentliche Psychotherapie-Termine in seinen Alltag integrieren. Das Problem wird verschärft, wenn lange Anfahrtswege erforderlich sind. Einzeltherapie ist teuer, da ein hoch spezialisierter Therapeut für jeweils eine Stunde bezahlt werden muss. Wird die Psychotherapie von der Krankenkasse übernommen, fallen diese Kosten zwar nicht für den Patienten an, wohl aber für die Gemeinschaft der Versicherten. Die meisten Antidepressiva sind sehr preiswert, da der Patentschutz ausgelaufen ist.“ (S. 168)
Mit anderen Worten: Bevor man Patienten zu einer möglichst langfristigen Gesundheit, mit möglichst wenigen Rückfällen verhilft, sollte man doch lieber auf die Kosten schauen. Das Ethos hinter dieser Argumentation verblüfft. Zuerst glaubt man, man hätte sich verlesen, doch etwas später erklärt er:
„Ein Vorteil einer Antidepressivabehandlung ist die unkomplizierte und nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit der Medikamente. Antidepressiva können über ein dichtes Apothekennetz bezogen und in nahezu jeder Menge produziert werden.“ (S. 169)
Demnach muss gar nicht jeder einzelne Patienten so gut wie möglich behandelt werden, sondern es reicht, wenn möglichst viele Patienten irgendwie behandelt oder versorgt werden.
Das sind Stellen, an denen man das Buch gerne aus der Hand legen möchte und das gilt auch, wenn man über die Wirksamkeit der Antidepressiva liest:
„Während es bei den Nebenwirkungen zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Antidepressiva gibt, ähneln sie sich in ihrer Wirkung. Das betrifft die Zuverlässigkeit, mit der auf eine Besserung gehofft werden kann (etwa 50 Prozent aller Patienten), die Dauer, bis die positive Wirkung eintritt (etwa drei bis vier Wochen), und die Effekte im Gehirn, nämlich die Verstärkung der Wirkung von Serotonin, Noradrenalin und bei einigen wenigen Antidepressiva auch Dopamin im synaptischen Spalt.“ (S. 63)
Jeder zweite Patient soll eine Besserung durch Antidepressiva erreichen? Wie sollen solche Werte bei so schwach wirksamen Medikamenten zustande kommen? Dazu muss man genauer lesen. Um auf diesen Wert zu kommen, ist es notwendig den medizinisch fragwürdigen Begriff „Response“ zu verwenden, der hier mit „Besserung“ übersetzt wird. Allerdings ist die „Response“ für Patienten ein vollkommen nutzloses Ereignis. Den Begriff „Response“ haben sich Pharmafirmen ausgedacht, um zu kaschieren, das ihr Medikament nur einen kurzzeitigen Effekt besitzt, der nicht zu einer Gesundung führt. Aus Patientensicht ist jedoch nur die „Remission“ (die Freiheit von Symptomen) ein akzeptabler Wert, denn Patienten wollen gesund werden und nicht auf der Hälfte der Strecke stehen gelassen werden, weil es ausreicht, dass sie bis dahin gekommen sind.
Der tatsächliche Wert für das Erreichen einer Remission liegt bei Antidepressiva bei neun Patienten. Das heißt, man muss neun Patienten mit Antidepressiva behandeln, damit einer von Ihnen besser reagiert, als wenn er mit Placebo behandelt worden wäre (Link und Link). Die anderen acht Patienten haben keinen Behandlungsvorteil aber müssen trotzdem die Nebenwirkungen wie Impotenz, Taubheit im Genitalbereich, Gewichtszunahme und Herzrhythmusstörungen aushalten. Man könnte das abwägen … oder man behandelt.
Und ein weiteres schwieriges Terrain, das für den Autor zur Behandlung dazugehört ist der Elektroschock. Nicht jeder Psychiater stimmt mit Bschors Einschätzung überein. Bschor schreibt: „So wie sie heutzutage durchgeführt wird, nämlich in Vollnarkose durch einen Anästhesisten (Narkosearzt), ist die Elektrokrampftherapie sicher und verträglich.“ (S. 208) – aber seit wann ist jede Vollnarkose sicher? Und dann liest man Dinge über den Elektroschock, die wissenschaftlich nicht bewiesen sind: „Antidepressiv wirksam ist nicht der Strom, sondern der dadurch ausgelöste Krampfanfall.“ (S. 208) Das verblüfft, denn bislang gilt das Wirkprinzip des Schocks als unbekannt.
Der Mediziner Florian Holsboer schrieb im Jahr 2009: „So weiß man über die Langzeiteffekte auf die Feinstruktur viel zu wenig. Auch ist unklar, ob die im Rahmen einer Elektrokrampftherapie auftretenden Gedächtnisstörungen nicht auch ungünstige Wirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit lange nach der Behandlung haben können. […]. Auch ich stehe der Elektrokrampftherapie kritisch gegenüber, vor allem weil völlig unklar ist und wohl auch bleiben muss, was in all den aberhundert Millionen Gehirnzellen vor sich geht, wenn ein von außen angelegter Wechselstrom hindurchgeleitet wird.“ (Biologie für die Seele, S. 65)
Schwer nachvollziehbar ist zudem der etwas unkritische Umgang mit Studien. Es ist mittlerweile bekannt, dass die ärztliche Einflussnahme in den allermeisten Studien über Antidepressiva – trotz Namensnennung unter der Veröffentlichung – nur sehr gering ist und die beteiligten Ärzte fast nie Zugriff auf die vollständigen Patientendaten haben. Dennoch wählt der Buchautor für die Beantwortung der Frage: „Macht es Sinn, ein Antidepressivum mit Mirtazapin zu kombinieren?“ eine solche Studiensuche und erklärt, gute Belege für eine Kombinationstherapie gefunden zu haben, obwohl eine hochwertigere Studie (der MIR trial), genau dieser Kombination jeglichen Nutzen abgesprochen hat (Link zum BMJ-Artikel).
Insgesamt hinterlässt das Buch den Leser ratlos. Soll man jetzt weiterhin Antidepressiva verordnen oder einnehmen? Was möchte der Autor aussagen? Was soll der Patient überhaupt wissen? Oder soll der Patient überhaupt etwas wissen?
Und an dieser Stelle wird es kritisch, denn wer zuvor dachte, Bschor habe sein Buch geschrieben, um aufzuklären und damit die Desinformation im Internet über Depressionen zu beenden, liest zu diesem Thema auf Seite 149 – ohne jedwede Einschränkung oder Warnung:
„Umfangreiche und seriöse Informationen bieten die Stiftung Deutsche Depressionshilfe (www.deutsche-depressionshilfe.de), das österreichische Bündnis gegen Depressionen (www.buendnis-depression.at) und die Schweizer Bündnisse gegen Depression (www.npg-rsp.ch).“ (S. 149)
Das erstaunt, denn genau diese Internetquellen schreiben: Eine Depression ist eine Funktionsstörung im Gehirn. Gegen diese Funktionsstörung wirken zielgenau antidepressive Medikamente. Antidepressive Medikamente haben kaum Nebenwirkungen und sind gut verträglich. Es gibt keine Abhängigkeit von Antidepressiva. – wenn diese Informationen für den Autor Bschor seriös sind, dann ist es absolut unverständlich, weshalb Bschor zusätzlich noch ein Buch schreiben musste.
Prof. Dr. med Tom Bschor
Antidepressiva – Wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte
223 Seiten Hardcover
Südwest 20,00 Euro
Update: Absetzen mit Professor Bschor?
Innerhalb der Psychiatergemeinde arbeiten aktuell Tom Bschor und Gerhard Gründer an ihrer Expertise zum Thema Absetzen.
Über 1000 Menschen besuchten ihren Vortrag auf der DGPPN-Tagung im Dezember 2018, die Pharmazeutische Zeitung titelte: Absetzen, aber richtig.
Zur Pharmazeutischen Zeitung:
Absetzen, aber richtig
Grund genug für Depression-Heute den Beitrag zu prüfen: Sollte sich die mächtigste Psychiatergemeinschaft von Deutschland (DGPPN) ernsthaft mit dem Absetzen beschäftigen und sollten Bschor und Gründer die ersten sein, die sich damit auskennen? Wir prüfen: Tom Bschor erklärt (Zitate aus der Pharmazeutischen Zeitung):
- „Die Abhängigkeit von der Halbwertszeit ist der Grund dafür, dass nach dem Absetzen des SSRI Fluoxetin so gut wie nie Entzugssymptome beobachtet werden, weil es eine sehr lange Halbwertszeit hat. »Fluoxetin schleicht sich gewissermaßen von selbst aus«, so Bschor.
- Entzugssymptome träten nur dann auf, wenn ein Antidepressivum zuvor über mindestens vier, eher acht Wochen genommen wurde. Nach diesem Zeitraum steige das Risiko durch eine noch längere Einnahme jedoch nicht weiter an. »Wenn ein Patient ein Antidepressivum acht Wochen lang eingenommen hat, dann erhöht sich das Risiko für Entzugssymptome nicht dadurch, dass er es noch ein oder fünf Jahre länger nimmt«, verdeutlichte der Mediziner.
- Sehr charakteristisch und beruhigend sei zudem, dass sich Entzugssymptome meist innerhalb von zwei bis maximal sechs Wochen spontan zurückbilden.
… und wir wissen wieder: Manche Leute reden gerne über Dinge, von denen sie nur sehr wenig Ahnung/ Erfahrung besitzen. Kommentar: Wer glaubt, dass es keinen Unterschied macht, ob jemand ein Medikament acht Wochen lang oder fünf Jahre lang eingenommen hat … weiß nicht, was er sagt. Wer behauptet, Fluoxetin schleicht sich von alleine aus, verblüfft mit Unwissenheit. Und wer beruhigend erklärt, Entzugssymptome bilden sich nach zwei bis maximal sechs Wochen zurück … der sollte lieber schweigen und erstmal seinen Patienten zuhören, bevor er sich ans Rednerpult wagt.
Ach so, gab es auf der Veranstaltung Tipps, wie man am besten absetzt? Oder wie man Entzugssymptome von der „Rückkehr“ der Erkrankung unterscheiden kann? Nein, natürlich nicht.







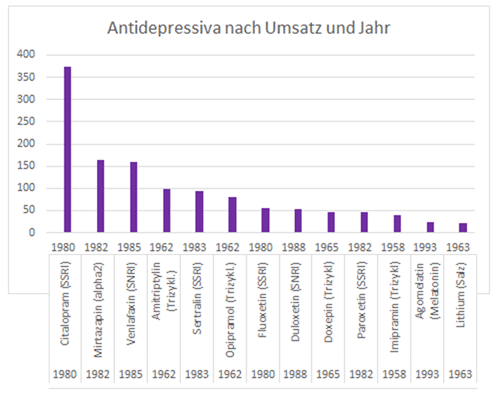

Vielen herzlichen Dank für diese fachgerechte Rezension und für Ihre ganze Arbeit und Mühe, für uns Betroffenen zu kämpfen! Unsere Patientenerfahrungen werden schon über viele Jahre schlicht nicht gewürdigt, sogar geleugnet. Dabei wäre es so einfach, mithilfe dieser Erfahrungen Schlüsse zu ziehen, Untersuchungen anzustreben und Studien anzufertigen.
Stattdessen kommen Jahr für Jahr solche unwahren Behauptungen zum Thema Entzugssymptome heraus, wie es in diesem Buch der Fall ist.
Gruß, Anna
P.S. Meine Freundin hat seit 3 Jahren ein andauerndes Entzugssyndrom vom abrupten Absetzen von Fluoxetin. Es gleicht keiner Depression und keine der Beschwerden hatte sie vorher, da sie es nicht für die Behandlung einer Depression bekommen hatte. Aber Hauptsache, es schleicht sich von selber aus.